
In der Online-Konferenz des Synodalen Weges am 4. und 5. Februar haben viele Synodale kritisiert, dass der Grundtext des Synodalforums „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“ schwer verständlich, ja gar theologisch zu sehr aufgeladen sei. Die Kritik erscheint mit Blick auf die Mitwirkendenstruktur des Synodalen Weges zwar plausibel; allerdings scheint sie die Ziele und die Verortung des Prozesses aus den Augen verloren zu haben. Ein Einwurf.
Zu viel Theologie?

Foto: © Synodaler Weg/Rosner
Der Synodale Weg nimmt – endlich, so möchte man fast sagen – Fahrt auf. War die erste Synodalversammlung im Februar vor einem Jahr vor allem von formalen Diskussionen und Abstimmungen rund um die Satzung geprägt und fanden die Regionenkonferenzen am 4. September 2020 ein Stück weit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so hatten in der Online-Konferenz am 4. und 5. Februar alle Synodalen (sowie die interessierte Öffentlichkeit) die Möglichkeit, sich über den Arbeitsfortschritt in den vier Synodalforen zu informieren und darüber ins Gespräch zu kommen.
Das Synodalforum „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ ist bisher am weitesten fortgeschritten: Es hat bereits einen Grundtext und drei Handlungstexte verabschiedet. In der Online-Konferenz stand nun vor allem der Grundtext im Zentrum der Diskussion – weniger aber aufgrund seiner inhaltlichen Ausführungen als vielmehr aufgrund seines sprachlichen Duktus sowie der Vielzahl an theologischen Fachbegriffen.
Viele Synodale kritisierten demnach, dass der Grundtext nur mit viel Mühe und Aufwand zu verstehen sei. Theologische Lai*innen einerseits, aber auch akademisch nicht beheimatete Menschen andererseits würden durch den Text nicht erreicht. Dieser Umstand sei umso schwerwiegender vor dem Hintergrund, dass die Botschaft und die Ergebnisse des Synodalforums auch für ‚normale‘ Katholik*innen von Bedeutung seien. Ein Diskussionsteilnehmer spitzte das Argument schließlich folgendermaßen zu: Der Grundtext stelle durch seine durch und durch exklusive (sprachliche) Gestalt eine Manifestation von Machtmissbrauch dar.
Das ist starker Tobak – aber einer, der an der Sache vorbei geht. Wenn ein Thema zur Disposition steht, das wesentliche kirchliche Vollzüge betrifft und das die hierarchische Verfassung der Kirche in ihrem Kern berührt, dann kommt man nicht umhin, dieses Thema vermittels eines bestimmten (auch begrifflichen) Instrumentariums und, damit zusammenhängend, in einer bestimmten Sprache zu reflektieren. Nur: Ist dies im Grundtext des „Machtforums“ überhaupt geschehen?
Nicht genug Theologie!
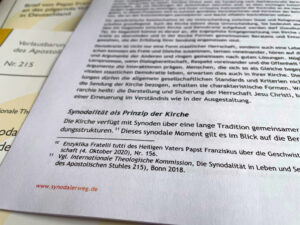
Das Dokument ruft wesentliche Impulse der Offenbarungstheologie und Ekklesiologie des II. Vatikanums in Erinnerung und verschränkt sie (in Bezug auf die Sakramentalität der Kirche) prononciert miteinander. Ebenso wird die wechselseitige Verwiesenheit von Tradition und Reform eingeholt und vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Pluralisierungsprozesse neu aufgeladen. Es werden verschiedene Begriffe präzisiert und ihr Gebrauch transparent gemacht – so bspw. die Begriffe der Macht sowie der Weihe- und Leitungsgewalt. Schließlich werden verschiedene Lösungsansätze für kirchliche Handlungsfelder und Entscheidungsprozeduren entwickelt – für alle ekklesialen Entscheidungsebenen: Pfarrei, Diözese, Bischofskonferenz und Weltkirche.
Zweifellos: Der Grundtext ist in hohem Maße ambitioniert. Nur: Was darin entfaltet und gefordert wird, steht schon seit Jahr(zehnt)en im Blickfeld theologischer und ekklesiologischer Forschung. Dass der Grundtext einen Bezug zu dieser Forschung hat, ist zwar nicht von der Hand zu weisen – die Verbindung ist aber allenfalls eine implizite. Eine explizite Auseinandersetzung mit und Bezugnahme auf ekklesiologische und machttheoretische Theorienbildung (um nur zwei Beispiele zu nennen) findet im Grundtext faktisch nicht statt.
Nur Schrift und Tradition?
Damit unterscheidet sich das Dokument nicht von einem x-beliebigen lehramtlichen Dokument. Lehramtliche Dokumente – wohlgemerkt auf jeder ekklesialen Ebene! – kennen insgesamt nur zwei Orte theologischer Erkenntnis: Schrift und Tradition. Aus diesen zwei Erkenntnisorten erwachsen, wie man im Fußnotenapparat solcher Dokumente eindrücklich erkennen kann, gemeinhin vier verschiedene Referenzgrößen: (1) die Hl. Schrift, (2) Kirchenväter, (3) frühere lehramtliche Dokumente (z. B. Konzilstexte, Enzykliken) und (4) öffentliche Äußerungen von Päpsten und Bischöfen.
Durch diese Verweisgrößen soll zwar idealiter der Eindruck einer Kontinuität zur bisherigen kirchlichen (Lehr)entwicklung entstehen. Faktisch aber verbleiben die Dokumente so in einem Modus des Selbstreferenzialität: Was sich außerhalb von Schrift und Tradition befindet (und dazu zählt schon die (akademische) Theologie!), ist de facto nicht beachtenswürdig. Von diesem Modus sind, nur um einige wenige Beispiele zu nennen, alle Dokumente des II. Vatikanums geprägt; von diesem Modus sind alle Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonferenz und von Papst Franziskus geprägt; und von diesem Modus ist nun auch der Grundtext des „Machtforums“ geprägt.

Symbolfoto: manhhai/Flickr; Lizenz: CC BY 2.0
Das II. Vatikanum hat der Kirche in seiner Pastoralkonstitution Gaudium et Spes auf die Fahne geschrieben, dass sie sich als eine lernende verstehen möge: von der Gesellschaft, von der Kultur und nicht zuletzt auch von den Wissenschaften (vgl. GS 44). Vor diesem Hintergrund sollte eine aktive Auseinandersetzung mit verschiedenen wissenschaftlichen Positionen in kirchlichen Dokumenten und Verlautbarungen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber es scheint, dass Bischöfen – die (zumindest als Diözesanbischöfe) in aller Regel akademisch ausgebildet und wissenschaftlich tätig gewesen sind – mit ihrer Bischofsweihe die Fähigkeit abhanden kommt, in ihren Schriften wissenschaftliche Standards anzuwenden. Das kirchliche Lehramt ist jedenfalls, das deckt der Blick in seine Veröffentlichungen in unmissverständlicher Weise auf, am Anspruch von Gaudium et Spes krachend gescheitert!
Auf dem falschen Weg?
Dass nun auch das „Machtforum“ mit seinem Grundtext den Weg der kirchlichen Selbstreferenzialität (und damit letztlich den Weg der wissenschaftlichen Isolation!) geht, muss hinterfragt werden – zumal angesichts der Mitwirkung so vieler renommierter Theolog*innen. Zwei Perspektiven sind dabei wesentlich: Das gegenwärtige Angefragt-Sein der akademischen Theologie einerseits und das Angefragt-Sein des Synodalen Weges andererseits.
Erstens: Ist es wirklich der Anspruch der (akademischen) Theologie, an Dokumenten mitzuarbeiten, die ihren eigenen wissenschaftlichen Standards nicht entsprechen? Kann sie sich das überhaupt leisten? Gerade vor dem Hintergrund, dass der Wissenschaftsstatus der Theologie immer wieder angezweifelt und ihr Platz im universitären Fächerkanon in Frage gestellt wird, drängt sich die Frage auf, ob die Mitwirkung von Theolog*innen an einem kirchlichen Prozess, der wissenschaftliche Standards unterläuft, nicht die Gefahr birgt, auf die Theologie projiziert zu werden.
Mit anderen Worten: Geraten nicht Theolog*innen (und mit ihnen sodann die Theologie im Allgemeinen) notwendigerweise in Verruf, die durch ihre Mitwirkung an einem Projekt der Kirche ihre eigenen Wissenschaftskriterien ignorieren – und sie damit ad absurdum führen?
Dieser Aspekt wird in den kommenden Jahren zunehmend an Relevanz gewinnen: Durch den Vorstoß der DBK, die Zahl der Priesterseminare radikal zu verringern, wird der Großteil der theologischen Fakultäten seine rechtliche Absicherung verlieren. Der Plausibilisierungsdruck der (universitär verorteten) Theologie wird also nochmals anwachsen. Vor diesem Hintergrund kann das Pochen auf wissenschaftliche Standards in den Dokumenten des Synodalen Weges Pate stehen für die Notwendigkeit einer umfassenden und (territorial) breit gefächerten Ausbildung von Volltheolog*innen.
Zweitens: Im Grundtext wird wiederholt die Möglichkeit und Umsetzbarkeit einer Gewaltenteilung in der Kirche betont und entsprechend eingefordert. Damit einher geht u. a. die Forderung nach mehr Machtkontrolle sowie nach einer transparenten Umsetzung und Überprüfung von Beschlüssen jedweder Art in der Kirche. Das folgende Zitat ist ein Beispiel unter vielen:
„Wir setzen uns […] dafür ein, das geltende Kirchenrecht so zu ändern, dass ein der Kirche angemessenes, in der eigenständigen Würde jeder getauften Person begründetes System von Gewaltenteilung, Entscheidungspartizipation und unabhängiger Machtkontrolle begründet wird.“
— Grundtext, S. 26f.
All dem entzieht sich das Lehramt nicht nur, weil es durch die hierarchische Verfassung der Kirche bisher schlechterdings nicht angefragt und kontrolliert werden kann (!), sondern auch, weil es in seinen Dokumenten und Verlautbarungen einen Stil pflegt, der sich akademischen und wissenschaftlichen Standards gegenüber isoliert! Wenn der Synodale Weg nun Dokumente verabschiedet, die in demselben Stil verfasst sind wie lehramtliche Texte, dann fällt hier ein wesentliches Medium der (Macht)kontrolle weg. Mehr noch: Man macht sich – ob gewollt oder nicht – mit dem kirchlichen Lehramt gemein.
Gerade weil der Synodale Weg grundlegend angefragt und kritisiert wird (sowohl mit Blick auf sein kirchenrechtliches Format als auch mit Blick auf die verhandelten Inhalte), scheint mir der folgende Ansatz der erfolgversprechendste zu sein: Die Flucht nach vorne. Man muss selbst mit voller Kraft vorangehen und alles auf die Karte einer substanziellen und wissenschaftlich fundierten Theologie setzen. Mehr Theologie wagen: Nur so kann der Synodale Weg sein Potenzial vollends ausnutzen – und nur so wird er seine Ziele dauerhaft erreichen.
Notwendige Vermittlung

Foto: © Synodaler Weg/Jochen Reichwein
Damit aber tritt die eingangs referierte Kritik am Grundtext des „Machtforums“ nochmals in verschärfter Form zutage. Dass die Kritik plausibel ist, verdeutlicht vor allem die Mitwirkendenstruktur des Synodalen Weges: Von den 230 Mitgliedern der Synodalversammlung dürfte etwa die Hälfte theologiefern sein. Dass der Synodale Weg von einer Vielzahl an Christ*innen verfolgt wird, die zwar in ihren Gemeinden, in verschiedenen Gremien, etc. mit Herzblut aktiv sind, aber ebenfalls keinen theologischen Background haben, kommt hinzu! Selbstverständlich ist daher die Forderung der Synodalen nach einer verständlichen und inklusiven Sprache (und – damit vermutlich zusammenhängend – nach der Möglichkeit einer breiteren Mitwirkung an den Beratungs- und Entscheidungsprozessen in den Synodalforen) angemessen.
Natürlich ist der Grundtext keine theologische Qualifikationsschrift; ebenso wenig können und wollen es die anderen Dokumente des Synodalen Weges sein. Nichtsdestoweniger: Die Auseinandersetzungen, die zur Entstehung des Synodalen Weges geführt haben und die nun verhandelt werden, sind vor allem theologische sowie ekklesiologische Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen können und werden – unter der Voraussetzung, dass das bessere Argument gewinnt! – nur auf der theologischen und ekklesiologischen Ebene, vermittels einer bestimmten Sprache und eines bestimmten Instrumentariums entschieden werden.
Gerade aufgrund dieser Konstellation sollte der Synodale Weg alles daran setzen, nicht unter seinen (theologischen) Möglichkeiten zu bleiben! Klar ist aber auch, dass diejenigen Synodalen (und alle Christ*innen), die nicht theologisch versiert sind, im weiteren Verlauf des Prozesses mitgenommen werden müssen. Es braucht eine Vermittlungsleistung – möglicherweise durch verschiedene Textfassungen (wie sie in den Synodalforen dem Vernehmen nach schon diskutiert werden).
Geschenkt, dass dies ein Mehr an Arbeit bedeutet! Aber der Ertrag wäre ein doppelter: Die gesamte Synodalversammlung und die Öffentlichkeit könnte in den zukünftigen Entwicklungen mitgenommen werden; gleichzeitig könnten die anstehenden Debatten auf höchstem theologischen Niveau geführt werden. Der Synodale Weg kann theologische Benchmarks setzen – die Möglichkeit muss nur genutzt werden: Mehr Theologie wagen!
